Wer an charakteristischer Reibeisenhaut leidet, empfindet diesen ästhetischen Makel nicht selten als Stigmatisierung, als erhebliche kosmetische und haptische Beeinträchtigung. Die häufige genetisch bedingte, jedoch harmlose Hauterkrankung bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen resultiert aus einer Überproduktion des strukturbildenden Proteins Keratin, gekennzeichnet durch follikuläre Hyperkeratose.
Erdbeerhaut: häufige follikuläre Hyperkeratose
Im Volksmund als Erdbeer- oder Reibeisenhaut bekannt, im Fachjargon als Keratosis pilaris, Lichen pilaris oder Keratosis follicularis bezeichnet – die häufige harmlose Hauterkrankung hat viele Gesichter. Die genetisch bedingte Verhornungsstörung ist zumeist bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit tendenziell trockener, atopischer Haut anzutreffen. An den Streckseiten der Oberarme und Oberschenkel sowie am Gesäß, seltener im Gesicht, bilden sich stecknadelkopfgroße weißliche bis rötliche Papeln in ausgedehnter Herdbesiedlung. Verhärtete Hornpfropfen infolge einer Überproduktion des strukturgebenden Proteins Keratin verschließen die Öffnungen der Haarfollikel – die rauen und schuppigen, teils entzündlichen Erhebungen und Knötchen umschreiben symptomatisch die follikuläre Hyperkeratose in unterschiedlichen Subtypen.
Genaue Ursachen für die Entstehung der im zunehmenden Lebensalter zumeist von selbst abklingenden Keratosis pilaris sind unklar, beobachtet wird ein gehäuftes Auftreten im Zusammenhang mit übermäßig schuppenden Hauterkrankungen wie atopische Dermatitis, Neurodermitis und Ichthyosis vulgaris oder krankhaften immunologischen Abwehrreaktionen wie Allergien. Die typische Gänsehaut-Zeichnung wird vermutlich über die mutierende Filaggrin-Gen-Fehlsteuerung autosomal dominant vererbt; eine familiäre genetische Prädisposition gilt hierbei als klinisch gesichert. Hormonelle Schwankungen in Pubertät, Schwangerschaft und Stillzeit können juckende Akutschübe auslösen, doch Vorsicht vor einem Aufkratzen der betroffenen Hautareale, welches wiederum weitreichende lokale Entzündungen und Schmierinfektionen begünstigt.
Eine ästhetisch und psychisch beeinträchtigende Hauterkrankung
Reibeisenhaut ist nicht heilbar, jedoch gut behandelbar und primär kosmetisch beeinträchtigend ohne gesundheitliche Einschränkungen auf die Lebensqualität. Für die jugendlichen Betroffenen stellt die zwar unbedenkliche, häufig über Jahre andauernde Hauterkrankung oftmals einen stigmatisierenden Makel dar, einen psychologisch tiefgreifenden Belastungszustand, der sich zu gesellschaftlicher Ausgrenzung und Mobbing auswachsen kann. Auffällige Verhornungsstörungen im frühen Kindesalter sollten präventiv ärztlich abgeklärt werden. Der Dermatologe bewertet nach Sichtdiagnose und Familienanamnese – moderne Dermatoskopie kommt zum Einsatz in der medizinischen Differentialdiagnostik der Subtypen mit unterschiedlich ausgeprägten Schweregraden wie Keratosis pilaris rubra oder Keratosis pilaris atrophicans.
Therapie mit Keratolytika
Die Individualtherapie bei Lichen pilaris unterliegt den vorherrschenden Symptomen, doch ist die konsequente Behandlung mit Keratolytika, verhornungslösenden sauren Substanzen, generell empfehlenswert. Zur regelmäßigen Heimanwendung sind harnstoff-, milchsäure- und salicylsäurehaltige Spezialpräparate gut verträglich. Die hautspezifische Pflege beinhaltet eine bewusste Körperhygiene und den Verzicht auf langes und zu heißes Duschen. Mild abschilfernde AHA-Peelings, seifenfreie unparfümierte Kosmetikprodukte ohne ätherische Öle mit Inhaltsstoffen wie Arganöl, Squalan, Vitamin A, marinen Wirkstoffen und Meerwasser verbessern das ästhetische Erscheinungsbild von Verhornungsstörungen. Hypoallergene, pH-neutrale NMF-Lotionen, Cremes und Hydro-Masken entwickeln zudem beruhigende, feuchtigkeitsspendende und sanft rückfettende Eigenschaften. Angeraten sind moderate Sonnenbäder, Saunabesuche und eine gluten- und zuckerfreie Ernährung mit vitaminreicher Frischkost und ausreichender Flüssigkeitszufuhr. Mechanische Hautreizung durch apparative Gerätetools und elektrokosmetische Hilfsmittel sollte möglichst vermieden werden. Wie bei allen dermatologischen Indikationen wesentlich zu beachten, beeinflussen Toxine, Allergene, Alkohol und Nikotin natürliche Zellschutzmechanismen, Sauerstoffanreicherung, Stoffwechsel- und Enzymprozesse negativ und befördern allgemein eine Verschlechterung der Hautqualität.







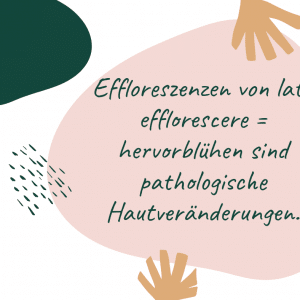
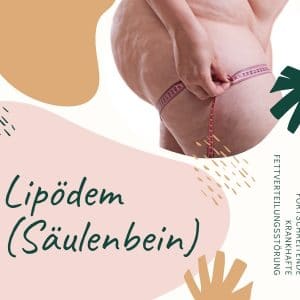




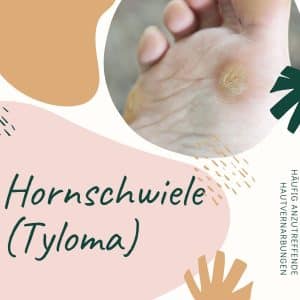


No Comments